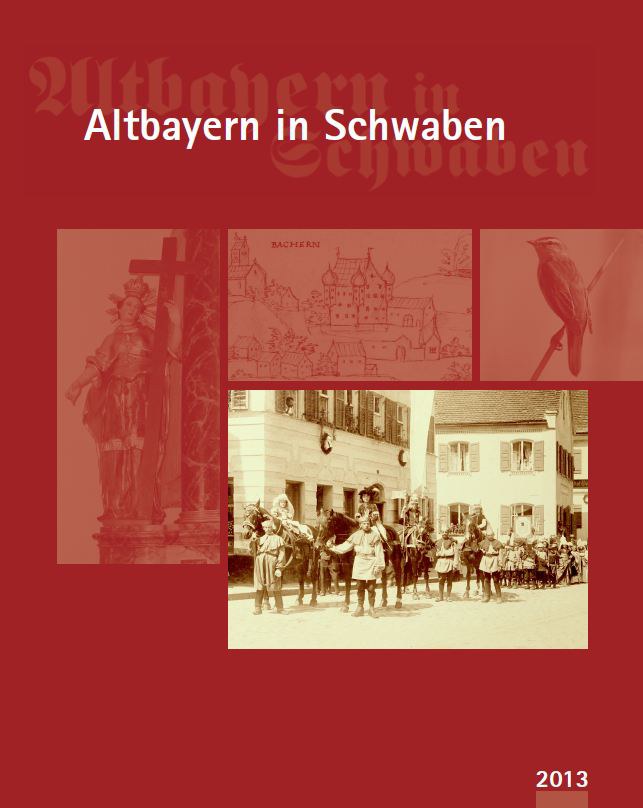
Landrat Christian Knauer
Vorwort 6
Dr. Gudrun Schmid
Der Wagesenberg bei Pöttmes, eine befestigte bronzezeitliche Höhensiedlung? 7
Michael Schmidberger
Zugewinn für Schiltberg: Die Kelten und die Latènezeit Ergebnisse der archäologischen Grabungen 2006 und 2012 17
Prof. Dr. Wilhelm Liebhart
Das Augustiner-Chorherrenstift Indersdorf als Grundherr im alten Landgericht Aichach Das Liber predialis von 1330 als Quelle zur frühen Ortsgeschichte im Wittelsbacher Land 33
Helmut Rischert
Burg, Hofmark und Schloss Bachern (siehe Leseprobe) 65
Rainer Roos
Die Glocken von Sankt Leonhard Das 300 Jahre alte Geläut in Inchenhofen 87
Dr. Hubert Raab
Wie die hl. Helena in den Kreuzweg kam 103
Ingo Aigner
Napoleon in Friedberg Der Raum Friedberg und Aichach im Schatten des dritten Koalitionskrieges 122
Horst Lechner
Rüdenfest! Welch ein Zauber liegt in diesem Worte für Aichachs Jugend! Zur Geschichte des Aichacher Kinderfestes 140
Georg Feuerer
Die Eingemeindung als Ende der kommunalen Selbstverwaltung in Lechhausen 164
Gerhard Mayer
Die Rohrsänger im Landkreis Aichach-Friedberg 177
Leseprobe
Burg, Hofmark und Schloss Bachern
Die Hofmarkenbeschreibung von 1606 nennt das Schloss Bachern ein feins drygädisch gemauerts hauß. Propst Antonius ließ das dreistöckige Gebäude mit vier Ecktürmchen ab 1595 á fundamentis (von Grund auf) neu erbauen und mit hohem Aufwand eine Wasserleitung in den Hof legen. 1596 kaufte er für 200 Gulden den Grund, einen Garten, auf dem das Schloss errichtet wurde. Die Maurerarbeiten besorgte Hans Lauser aus Leitershofen mit zwei Söhnen. Der Untergaden war am 15. Juli 1595 fertig, die beiden Obergaden erst Ende 1597. Der Steinmetzmeister Jakob Stag arbeitete vom 6. Juni 1595 bis 6. April 1597. Der Zimmermeister Thomas Steinler wurde verdingt, die zwei oberen Zimmer – das sogenannte Weiße Zimmer im ersten und das Prälatenzimmer im zweiten Stock – außzumachen (wohl: zu vertäfeln). Die Zimmerleute aus Bachern mit Meister Kaspar von Batzenhofen begannen ihre Arbeiten am 10. Mai 1595. Sie stellten die Dächer von Pfleghauß, Stallungen und Stadel her und fertigten das Thüll, die festen Bretterzäune um die Gärten. Die vier Türmchen waren mit vergoldeten (!) Schindeln gedeckt. Am Haus waren eine Sonnenuhr und das Wappen des Erbauers angebracht. Im Hof befand sich ein Gumber (Pumpbrunnen), ein hölzerner Röhrkasten mit Säule und Knopf. Das wasserwerckh (Wasserleitung) wurde 1598/99 hergestellt. Die Gesamtkosten für den Schlossbau beliefen sich auf 5854 Gulden. Im Erdgeschoss lagen die Kapelle, das Amtszimmer und die Küche, im ersten Stock das Weiße Zimmer mit zwei Nebenzimmern und die Casserm (Wachstube), im zweiten Stock das Prälatenzimmer und der Saal, darüber der Getreideboden. Die Stiege im Fletz (Hausflur) des oberen Stocks hatte ein eisernes Gitter.